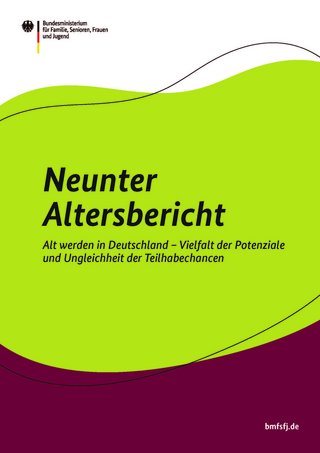Am Montag, den 29.09.2025, fand das AGF-Fachgespräch „9. Altersbericht: Vielfalt, Ungleichheiten und familiäre Unterstützung im Alter” statt.
Prof. Dr. Tesch-Römer stellte dabei die zentralen Inhalte des 9. Altersberichts vor und legte den Fokus auf die Themen Vielfalt, Ungleichheit und familiäre Unterstützung im Alter.
Seine Präsentation finden Sie hier: Präsentation CTR 9. Altersbericht
Clemens Tesch-Römer stellte die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen ins Zentrum seines Vortrags. Er betonte, dass Teilhabechancen stark ungleich verteilt sind – etwa abhängig von Bildung, Einkommen, Geschlecht, Gesundheit, Migrationsstatus oder sexueller Identität.
Er präsentierte Befunde zu ungleichheitsrelevanten Aspekten wie Altersarmut, Ageismus, ungleichen Zugang zu Kultur, Bildung, politischer Mitwirkung und Ehrenamt. Besonders problematisch sei die Intersektionalität, also die Überschneidung verschiedener Ungleichheitsdimensionen, die bei den Betroffenen zu gravierenden Benachteiligungen führt.
Auch wenn Familien im Alltag älterer Menschen eine bedeutende Rolle spielen, etwa wenn sie selbst Enkelbetreuung leisten oder im Pflegefall Unterstützung von Familienmitgliedern erhalten, ist Familie im 9. Altersbericht kein Schwerpunktthema.
Tesch-Römer hob hervor, dass vor allem Sorgearbeit, die häufig von Frauen geleistet wird, erhebliche Belastungen mit sich bringt und bessere politische Rahmenbedingungen erfordert. Er nannte als Beispiele die Weiterentwicklung von Pflegezeitregelungen und eine Reform der Altenhilfe.

Insgesamt sei es notwendig, gesellschaftliche Vielfalt anzuerkennen, Ageismus zu bekämpfen und politische Maßnahmen so auszurichten, dass auch benachteiligte Gruppen im Alter echte Chancen auf Teilhabe haben.
Diskussion
Im Zentrum der Diskussion stand zunächst die ungleiche Verteilung des ehrenamtlichen Engagements. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Beteiligung am Ehrenamt im Altersverlauf insgesamt abnimmt. Besonders diskutiert wurde die Frage, weshalb Frauen seltener ehrenamtlich aktiv sind. Hier wurde herausgestellt, dass dies nicht auf ein geringeres Interesse zurückzuführen sei, sondern vielmehr auf strukturelle Hindernisse: Frauen übernehmen im Lebensverlauf häufiger Sorgearbeit in Familie und Pflege, wodurch ihnen weniger Zeit und Energie für freiwilliges Engagement bleibt. Zudem sind die Angebote und Strukturen vieler Organisationen oft stärker auf Männer zugeschnitten, was Frauen den Zugang erschwert. Am Beispiel von Menschen mit Migrationsgeschichte wurde problematisiert, ob die bestehenden Forschungsinstrumente das tatsächliche Engagement dieser Gruppen angemessen erfassen. Viele Migrantinnen und Migranten engagieren sich im familiären oder nachbarschaftlichen Umfeld, in Vereinen oder religiösen Gemeinschaften – Tätigkeiten.
Prof. Tesch-Römer betonte in diesem Zusammenhang, dass die Datenlage insgesamt relativ gut sei. Niedrigere Engagementquoten bei bestimmten Gruppen müssten weniger als Ausdruck fehlender Bereitschaft verstanden werden, sondern vielmehr als Spiegel sozialer Benachteiligung. Bestimmten Bevölkerungsgruppen sei der Zugang zum Ehrenamt als Ressource deutlich erschwert – sei es durch sprachliche, organisatorische oder kulturelle Barrieren.
Im zweiten Schwerpunkt der Diskussion wurde die familiäre Pflege in den Blick genommen. Hier wurde hervorgehoben, dass der politische Fokus noch stärker auf diese Form der Sorgearbeit gerichtet werden müsse, da sie das Fundament der Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Deutschland darstellt. Für die pflegenden Angehörigen bedeutet ihr Engagement erhebliche Belastungen, die bislang von staatlicher Seite nicht ausreichend abgefedert werden. Dies betrifft zum einen die materiellen Folgen, insbesondere für Frauen, die durch die Übernahme von Pflegeverantwortung Einkommenseinbußen hinnehmen müssen und dadurch langfristig ein erhöhtes Risiko von Altersarmut tragen. Zum anderen wurde die unzureichende Ausgestaltung von Unterstützungsstrukturen kritisiert: Angebote zur Entlastung seien häufig zu starr oder nicht ausreichend verfügbar, und die Beratungslandschaft zur häuslichen Pflege sei unübersichtlich und schwer zugänglich. Hervorgehoben wurde zudem, dass kommunale Angebote und eine stärkere Steuerung auf lokaler Ebene dringend ausgebaut werden müssten, um Familien verlässliche Unterstützung zu sichern. Als ein weiterer wichtiger Schritt wurde die Einführung einer finanziellen Leistung wie des geplanten Familienpflegegeldes angesehen, das pflegende Angehörige besser absichern könnte.
Ein weiterer Diskussionspunkt war die Notwendigkeit, Männer stärker in die Care-Arbeit einzubeziehen. Nur wenn auch Männer Verantwortung in der familiären Pflege übernehmen, könne der wachsende Bedarf gedeckt und die Verteilung der Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern gerechter gestaltet werden. Gleichzeitig wurde aber darauf hingewiesen, dass im öffentlichen Diskurs teilweise gegenteilige Tendenzen sichtbar sind: Durch die im Zuge der Debatten um Verteidigungsfähigkeit geförderten traditionellen Männerbilder bestehe die Gefahr eines Backlashs, der die Tendenz zu einer höheren Bereitschaft zur Care Arbeit unter Männern in Frage stelle.
Abschließend wurde betont, dass Altersberichte künftig die familiäre Perspektive deutlich stärker berücksichtigen sollten, da familiäre Unterstützung nach wie vor ein zentrales Element sozialer Netze im Alter darstellt.